Häufige Krankheitsbilder
Orthopädie
Hüftgelenksarthrose (Coxarthrose)
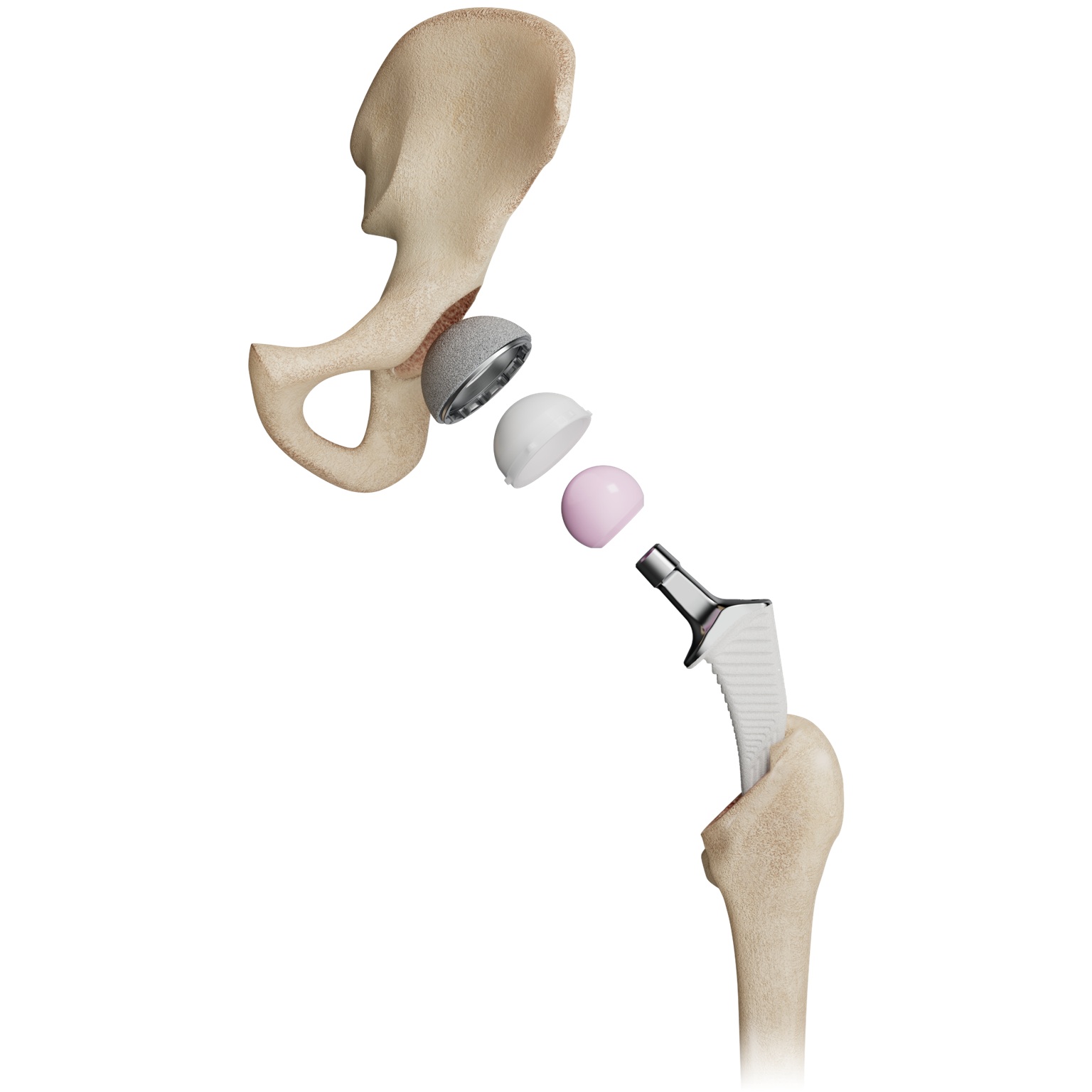
Was ist das?
Die Hüftarthrose ist eine Abnutzung des Knorpels im Hüftgelenk.
Sie entsteht meist langsam und kann Schmerzen und Steifheit verursachen.
Ursachen
- Alter
- Vererbung
- Fehlstellungen (z. B. Hüftdysplasie)
- Übergewicht
- Verletzungen
- Entzündungen (z. B. Rheuma)
Symptome
- Schmerzen in Leiste oder Oberschenkel
- Steifheit am Morgen oder nach dem Sitzen
- Eingeschränkte Beweglichkeit
- Hinken oder unsicherer Gang
Diagnose
- Ärztliche Untersuchung
- Röntgen
- Bei Bedarf: MRT oder CT
Behandlung
Ohne Operation
- Bewegung & Physiotherapie
- Schmerzmittel, entzündungshemmende Medikamente
- Gewichtsreduktion
- Einlagen, Gehhilfen
- Wärme, Kälte, Elektrotherapie
Mit Operation
- Gelenkerhaltende OP (bei Fehlstellungen)
- Künstliches Hüftgelenk (bei starkem Verschleiß) in minimalinvasiver Technik
Ablauf:
- Schonender Eingriff
- 2-5 Tage im Spital
Tipps für den Alltag
- Regelmäßig bewegen
- Gelenke nicht überlasten
- Gesund ernähren
- Rehasport & Unterstützung nutzen
Häufige Fragen
Kann Arthrose geheilt werden?
Nein, aber gut behandelt werden.
Wie lange hält ein künstliches Gelenk?
Meist 15–20 Jahre oder länger.
Spürt man das Gelenk?
Nach der anfänglichen Rehabilitationszeit oft kaum noch.
Hallux valgus - die "Schiefzehe"

Was ist das?
Der Hallux valgus ist eine Fehlstellung der großen Zehe:
- Die Zehe neigt sich mit der Spitze in Richtung Fußmitte
- Der Großzehenballen wölbt sich nach innen
Das kann zu Schmerzen, Druckstellen und Problemen beim Gehen oder Schuhtragen führen.
Ursachen
- Vererbung / schwaches Bindegewebe
- Enge, hohe oder spitze Schuhe
- Fußfehlstellungen (Spreizfuß, Plattfuß)
- Rheuma
- Übergewicht
- Häufig bei Frauen – durch weicheres Bindegewebe und modisches Schuhwerk
Symptome
- Schmerzen am Großzehenballen
- Rötung, Schwellung oder Hühneraugen
- Probleme beim Tragen von geschlossenen Schuhen
- Überlastung des Vorfusses (Metatarsalgie)
- In fortgeschrittenen Fällen: Verformung anderer Zehen
Diagnose
- Ärztliche Untersuchung
- Röntgen der Füsse im Stehen zur Winkelmessung
- ggf. Fußabdruckanalyse (z. B. bei Spreizfuß)
Behandlung
Konservativ (ohne OP)
Schuhanpassung
- Weite, flache Schuhe mit Zehenfreiheit und weichem Obermaterial ohne Nähte
- Einlagen zur Druckentlastung
- Nachtschienen (v. a. bei Jugendlichen) als Schmerztherapie
- Muskeltraining & Barfußgehen
- Schmerzmittel, Kälte, entzündungshemmende Salben
ℹ️ Konservative Maßnahmen können die Fehlstellung nicht korrigieren – aber Beschwerden lindern und das Fortschreiten verlangsamen.
Operativ
Wann?
Wenn Schmerzen zunehmen oder konservative Methoden nicht helfen.
Ziele der OP:
- Zehe wieder in die natürliche Achse bringen
- Schmerzen lindern
- Bessere Gehfähigkeit & Schuhverträglichkeit
Häufige OP-Methoden:
- Chevron- und Akin-Osteotomie (leichte/mittlere Fehlstellung) offen oder minimalinvasiv
- Lapidus-OP (bei instabiler Fußwurzel/starker Fehlstellung)
Nach der OP:
- je nach notwendiger OP-Methode Vorfußentlastungsschuh für 4–6 Wochen oder Gipsruhigstellung
- Thromboseprophylaxe
- Physiotherapie & Nachsorge
Leben mit Hallux valgus
- Bequeme, fußgerechte Schuhe tragen
- Fußmuskulatur trainieren (Barfussgehen)
- Übergewicht vermeiden
- Frühzeitig ärztlichen Rat suchen
Häufige Fragen (FAQ)
Geht ein Hallux valgus von selbst weg?
Nein – unbehandelt kann er sich verschlechtern.
Ist die OP schmerzhaft?
Die Schmerzen sind gut behandelbar mit moderner Schmerztherapie.
Wann kann ich wieder normal gehen?
Nach ca. 6–8 Wochen – abhängig von der OP-Methode.
Kommt der Hallux valgus zurück?
In Einzelfällen – besonders bei falschem Schuhwerk oder zu früher Belastung.
Wann zum Arzt?
- Bei Schmerzen am Großzehenballen
- Wenn Schuhe zunehmend drücken
- Bei sichtbarer Fehlstellung
Kreuzbandriss
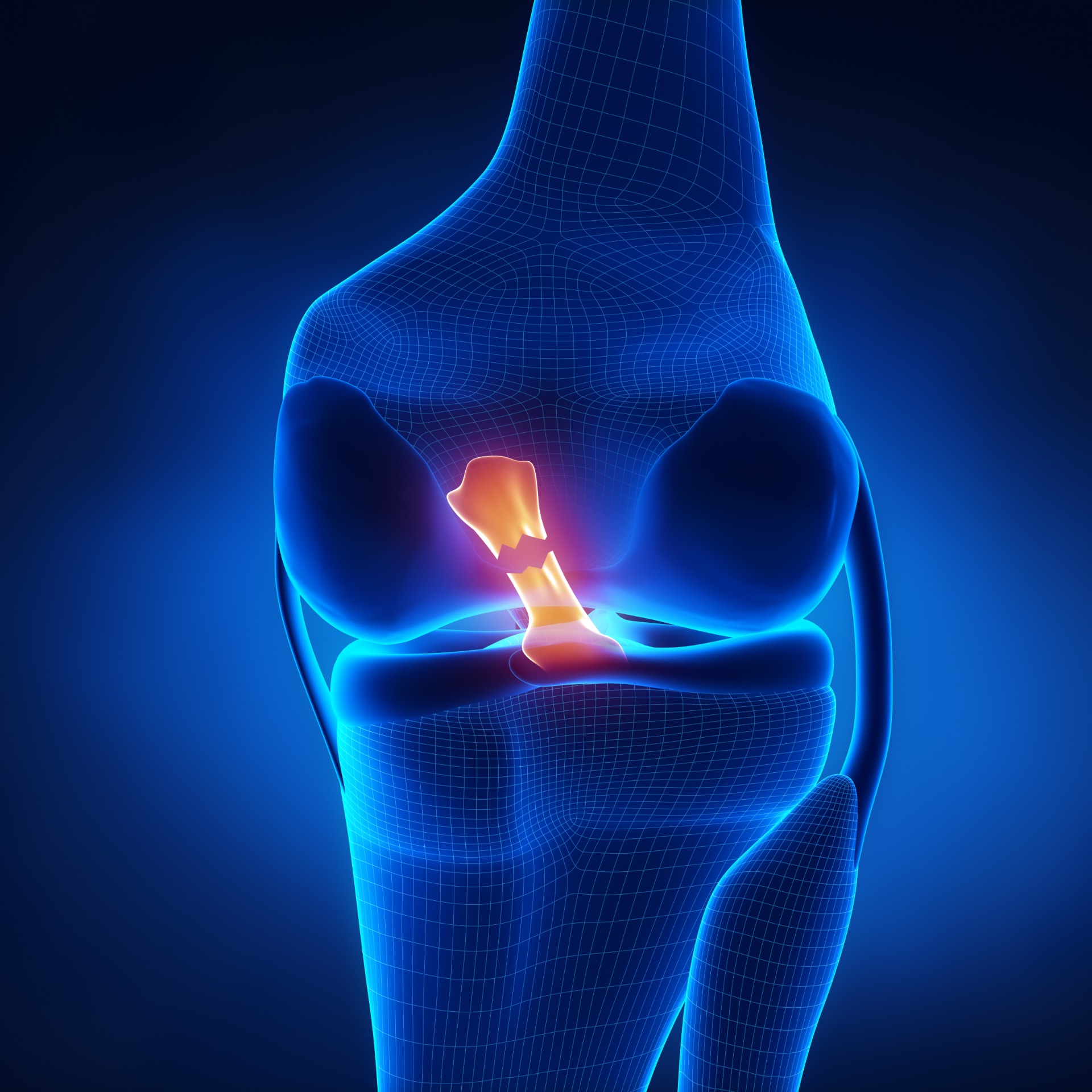
Kreuzbandriss – was ist das?
Im Knie verlaufen zwei wichtige Bänder:
🔹 Vorderes Kreuzband (VKB)
🔹 Hinteres Kreuzband (HKB)
Sie stabilisieren das Knie bei Bewegung. Reißt eines davon – meist das vordere – spricht man von einem Kreuzbandriss.
Ursachen
Ein Riss entsteht meist durch plötzliche, starke Belastung – z. B.:
-
Verdrehung beim Sport (Fußball, Ski, Handball)
-
Stürze oder direkte Krafteinwirkung
Symptome
Ein Kreuzbandriss macht sich oft sofort bemerkbar:
- Stechender Schmerz
- Knallgeräusch beim Riss ("Schnappen")
- Schwellung des Knies
- Instabilität oder Wegknicken
- Eingeschränkte Beweglichkeit
Diagnose
-
Ärztliche Untersuchung & Bewegungstests
Röntgen: schließt Knochenbrüche aus
-
MRT: zeigt Bänderrisse und Begleitverletzungen
Behandlungsmöglichkeiten
Konservativ (ohne OP)
Geeignet bei:
-
Teilrissen oder stabilem Knie
-
geringer sportlicher Belastung
Therapie:
- Physiotherapie (Muskelaufbau & Stabilität)
- Orthese (Kniebandage)
- Sportpause & Alltagsanpassung
Operativ (Kreuzbandplastik)
Empfohlen bei:
-
anhaltender Instabilität
-
sportlich aktiven Patient:innen
-
Begleitverletzungen
Ablauf:
- Ersatz des Bandes durch körpereigene Sehne
- Meist arthroskopisch (minimalinvasiv)
- Ambulant oder kurzer Klinikaufenthalt
Nach der OP:
- Orthese für 4–6 Wochen
- Physiotherapie & Reha-Plan
- Joggen nach ca. 3 Monaten
- Kontaktsport frühestens nach 6–9 Monaten
Leben mit Kreuzbandriss
- Sport ist oft wieder möglich
- Gute Heilung – mit oder ohne OP
- Geduld in der Reha ist entscheidend
⚠️ Bei unbehandelter Instabilität drohen Spätfolgen (Meniskus, Arthrose)
Häufige Fragen
Muss jeder Kreuzbandriss operiert werden?
Nein – bei stabiler Situation ist auch eine konservative Behandlung erfolgreich.
Wie lange bin ich krankgeschrieben?
-
Büro: ca. 2–3 Wochen
-
körperlich aktiv: 6–12 Wochen
Wann darf ich wieder Sport machen?
-
Radfahren: nach 6–8 Wochen
-
Kontaktsport: frühestens nach 6–9 Monaten
Wann zum Arzt?
- Nach Knieverletzung mit Instabilität oder Schwellung
- Wenn das Knie immer wieder "wegknickt"
- Bei Unsicherheit im Alltag oder Sport
Kniegelenksarthrose (Gonarthrose)

Was ist das?
Kniearthrose ist der fortschreitende Verschleiß des Knorpels im Kniegelenk.
Typisch: Schmerzen, Steifheit, eingeschränkte Beweglichkeit.
Ursachen
- Alter
- Übergewicht
- X-/O-Beine (Fehlstellungen)
- Knieverletzungen (z. B. Meniskus, Kreuzband)
- Starke Belastung (z. B. beim Sport)
- Entzündliche Erkrankungen (z. B. Rheuma)
- Vererbung
Symptome
- Knieschmerzen – zuerst bei Belastung, später auch in Ruhe
- Morgensteifigkeit
- Schwellung / Wärme bei Reizung
- Bewegungseinschränkung (z. B. beim Treppensteigen)
- Instabilität oder Unsicherheit beim Gehen
Diagnose
- Gespräch & körperliche Untersuchung
- Röntgen (zeigt Gelenkveränderungen)
- MRT (bei Bedarf zur Weichteilbeurteilung)
Behandlung
Ohne Operation
Physiotherapie
- Muskelaufbau, Beweglichkeit, Koordination
Medikamente & Injektionen
- Schmerzmittel, Salben, Kortison oder Hyaluronsäure, Eigenbluttherapie
Gewichtsreduktion
- Schon 5 kg weniger entlasten das Knie deutlich
Orthopädische Hilfen
- Bandagen, Gehhilfen
Physikalische Therapien
- Kälte (akut), Wärme (chronisch), Reizstrom, Ultraschall
Mit Operation
- Knorpelersatzplastiken bei kleineren Defekten
- Korrektur bei Fehlstellungen (Osteotomie)
Kniegelenkersatz (Prothese)
- Teilprothese (nur ein Bereich betroffen)
- Vollprothese (gesamtes Knie betroffen)
Ablauf:
- Spitalaufenthalt: ca. 4-6 Tage
- Danach intensive Physiotherapie zur Wiederherstellung von Beweglichkeit & Kraft
Alltag mit Kniearthrose
- Bewegen Sie sich regelmäßig
- Vermeiden Sie Übergewicht
- Gelenkschonende Sportarten: Schwimmen, Radfahren, Nordic Walking
- Lange Inaktivität vermeiden
Häufige Fragen
Ist die Arthrose des Knies heilbar?
Nein, aber gut behandelbar.
Belastbarkeit nach Prothese?
Ja – Alltag und sogar moderater Sport sind oft wieder möglich.
Haltbarkeit der Prothese?
In der Regel 15–20 Jahre oder länger
Hammer- und Krallenzehen

Was sind Hammerzehen?
Eine Hammerzehe ist eine Fehlstellung, bei der das mittlere Zehengelenk dauerhaft gebeugt ist. Meist ist die zweite Zehe betroffen. Es gibt auch Varianten wie Krallen- oder Mallet-Zehen. Diese Fehlstellung kann Schmerzen und Probleme beim Gehen oder Schuhtragen verursachen.
Ursachen
-
Enges, spitzes oder hohes Schuhwerk
-
Spreizfuß
-
Fehlstellungen wie Hallux valgus
-
Schwaches Bindegewebe oder Muskelungleichgewicht
-
Rheuma, Verletzungen oder neurologische Erkrankungen
Symptome
-
Gebogene Zehe(n)
-
Druckschmerzen am Gelenk
-
Hühneraugen (Clavus)
-
Schmerzen beim Gehen
-
Überlagerung anderer Zehen
-
In schweren Fällen: Versteifung
Diagnose
-
Untersuchung des Fußes
-
Röntgen im Stehen
-
Bei Bedarf Abklärung weiterer Erkrankungen
Behandlung
Konservativ (frühe Stadien):
-
Bequeme, weite Schuhe ohne Absatz
-
Einlagen und Zehenpolster
-
Fußgymnastik zur Kräftigung
-
Schmerz- und Druckschutz (z.B. Silikonringe)
ℹ️ Diese Maßnahmen lindern Beschwerden und verlangsamen das Fortschreiten, korrigieren aber nicht die Fehlstellung.
Operativ
Wann?
Bei starken Schmerzen oder Hautproblemen.
Ziel der OP:
-
Korrektur der Fehlstellung
Häufige OP-Methoden:
-
Sehnenverlängerung oder Knochenkorrektur
Nach der OP:
- Entlastungsschuh, Physiotherapie, Heilung 4–8 Wochen
Leben mit Hammerzehen
-
Tragen Sie passende, fußfreundliche Schuhe mit weiter Zehenbox
-
Trainieren Sie Fuß- und Zehenmuskulatur regelmäßig
-
Suchen Sie frühzeitig ärztlichen Rat
Häufige Fragen (FAQ)
Kann ich mit Hammerzehen Sport machen?
Ja, wenn keine Schmerzen bestehen und das Schuhwerk passt.
Heilt Gymnastik die Fehlstellung?
Nein, aber sie lindert Beschwerden und verlangsamt die Entwicklung.
Ist die OP schmerzhaft?
Moderne Methoden machen die Schmerzen gut beherrschbar.
Wann zum Arzt?
Bei Schmerzen, Druckstellen, Fehlstellungen oder Problemen mit Schuhen.
Sprunggelenksdistorsion (Verstauchung)

Was ist das?
Beim Umknicken des Sprunggelenks kommt es häufig zu einer Überdehnung oder einem Riss der Außenbänder. Das ist eine der häufigsten Sport- und Alltagsverletzungen.
Typische Symptome
-
Plötzlicher Schmerz am Außenknöchel
-
Schwellung, evtl. Bluterguss
-
Bewegungseinschränkung
-
Gefühl von Instabilität
Ursachen
-
Sport (z. B. Fußball, Tennis, Skifahren)
-
Unebener Untergrund
-
Hohes Schuhwerk / Absätze
-
Schwache Muskulatur oder frühere Verletzungen
Schweregrade
Grad I: Überdehnung (leichte Schmerzen, keine Instabilität)
Grad II: Teilriss (deutliche Schwellung, eingeschränkte Belastbarkeit)
Grad III: Kompletter Riss (starke Schmerzen, Instabilität)
Diagnose
-
Ärztliche Untersuchung
-
Röntgen zum Ausschluss eines Bruchs
-
MRT bei unklaren oder schweren Fällen
Behandlung
meist konservativ
1. Akutmaßnahmen – PECH-Regel:
Pause – Eis – Compression – Hochlagern
2. Stabilisierung:
je nach Schweregrad kurzfristige Ruhigstellung im Walker mit Stockentlastung und anschliessend Sprungelenksbandage für insgesamt 6 Wochen
3. Physiotherapie:
Frühzeitige Mobilisierung, Muskelaufbau, Koordination
4. Medikamente:
Schmerzmittel, abschwellende Salben
Operation – nur in Ausnahmefällen:
-
Komplette Risse mit starker Instabilität
-
Leistungssportler
-
Versagen der konservativen Therapie
Heilungsverlauf
-
Leichte Verletzungen: 1–2 Wochen
-
Mittelschwer: 3–6 Wochen
-
Schwere Risse: bis zu 10 Wochen
➡️ Sportpause: meist 6–12 Wochen
Vorbeugung
-
Aufwärmen vor dem Sport
-
Stabiles Schuhwerk
-
Balance- & Krafttraining
-
Bandagen/Tapes bei Instabilität
Häufige Fragen (FAQ)
Wann darf ich wieder auftreten?
Je nach Schweregrad – oft nach wenigen Tagen mit Bandage.
Muss ein Bänderriss operiert werden?
Nur selten – meist ist eine konservative Behandlung erfolgreich.
Was passiert ohne Therapie?
Es drohen chronische Instabilität, erneutes Umknicken und Gelenkverschleiß (Arthrose).
Arthrose des Schultergelenkes (Omarthrose)
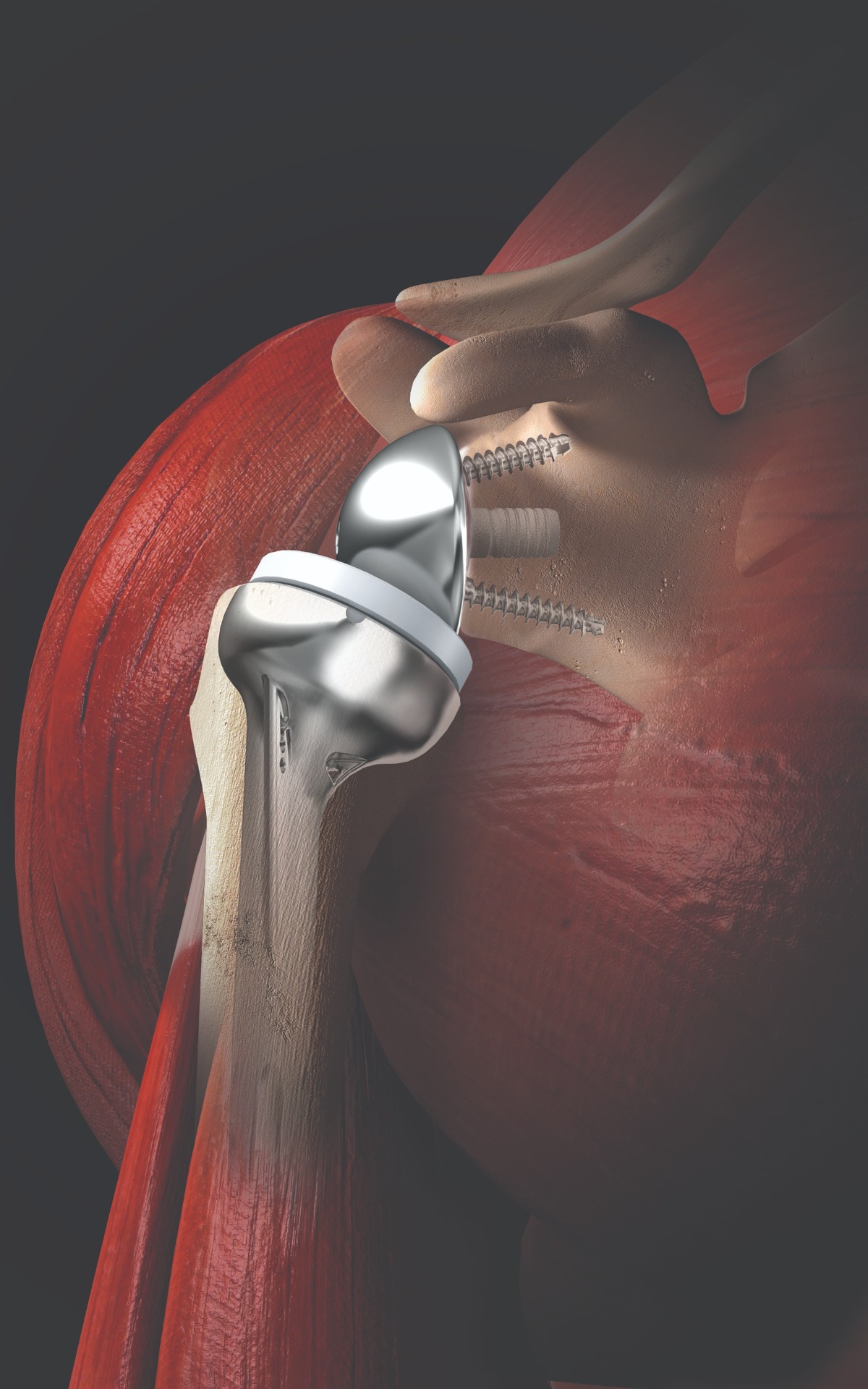
Was ist das?
Bei Schulterarthrose nutzt sich der Gelenkknorpel im Schultergelenk langsam ab.
Folge: Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Kraftverlust im Arm.
Ursachen
- Alter
- Schulterverletzungen oder -operationen
- Risse der Rotatorenmanschette
- Fehl- oder Überbelastung
- Rheuma oder andere Entzündungen
- Durchblutungsstörungen im Oberarmkopf
Typische Symptome
- Schulterschmerzen – erst bei Belastung, später auch in Ruhe oder nachts
- Eingeschränkte Beweglichkeit (z. B. beim Heben des Arms)
- Kraftverlust
- Schmerzen beim Liegen auf der Schulter
- In schweren Fällen: steife Schulter
Diagnose
- Ärztliches Gespräch & Untersuchung
- Röntgen (Knorpelverschleiß, Gelenkform)
- MRT oder CT bei unklarer Ursache oder zur Beurteilung der Weichteile
Behandlung
Konservativ (ohne OP)
Medikamente & Injektionen
- Schmerzmittel, Entzündungshemmer
- Kortison- , Hyaluronsäure- oder Eigenblut-Injektionen
Physiotherapie & Bewegung
- Muskeln stärken
- Beweglichkeit erhalten
Physikalische Maßnahmen
- Wärme oder Kälte
- Ultraschall, Elektrotherapie, Stoßwelle
Alltagshilfen & Schonung
- Greifhilfen, ergonomische Anpassungen
- Überlastung vermeiden
Operativ
Gelenkerhaltende Eingriffe
- Arthroskopie (Knorpelglättung)
- Sehnenrekonstruktion
Künstliches Schultergelenk (Prothese)
- Anatomisch: bei intakter Muskulatur
- Inverse Prothese: bei geschädigter Rotatorenmanschette
Ziele der OP:
- Weniger Schmerzen
- Mehr Beweglichkeit
- Höhere Lebensqualität
Reha danach:
- Mehrere Wochen bis Monate
- Geduld & regelmäßige Physiotherapie sind wichtig
Leben mit Schulterarthrose
- Regelmäßig bewegen – aber gelenkschonend
- Ergonomische Haltungen beachten
- Schulter nicht dauerhaft belasten oder draufliegen
- Frühzeitig handeln – rechtzeitige Behandlung hilft
Häufige Fragen
Kann man Schulterarthrose heilen?
Nein, aber Beschwerden lassen sich meist gut behandeln.
Ist eine Prothese spürbar?
Viele empfinden die neue Schulter nach der Reha als deutlich schmerzfreier und beweglicher.
Wie lange hält eine Schulterprothese?
Oft 10–20 Jahre – abhängig von Belastung und Prothesentyp.
Wann zum Arzt?
- Schulterschmerzen über Wochen
- Einschränkungen beim Heben oder Drehen des Arms
- Nächtliche Schmerzen oder Kraftverlust
- Gefühl von Instabilität in der Schulter
Der Knick Senk Fuss

Was ist das?
Ein Knick-Senkfuß ist eine häufige Fußfehlstellung:
-
Das Längsgewölbe ist abgesenkt (Senkfuß)
-
Die Ferse kippt nach innen (Knickfuß)
Oft ist die Fehlstellung schmerzfrei – unbehandelt kann sie aber Beschwerden und Fehlhaltungen verursachen.
Ursachen
-
Schwaches Bindegewebe (v. a. bei Kindern)
-
Übergewicht
-
Falsches oder zu weiches Schuhwerk
-
Bewegungsmangel
-
Verletzungen oder rheumatische Erkrankungen
Symptome
-
Fußschmerzen (v. a. innen oder an der Ferse)
-
Schnelles Ermüden beim Gehen/Stehen
-
Druckstellen, Schwielen
-
Gangveränderung (Ferse kippt einwärts)
-
Bei Erwachsenen: Knie-, Hüft- oder Rückenschmerzen
Diagnose
-
Körperliche Untersuchung & Fußabdruck
-
Ganganalyse
-
Röntgen des belasteten Fusses zur Winkelmessung
ggf. MRI oder SPECT-CT zur weiteren Diagnostik
Behandlung
Konservativ
In vielen Fällen ausreichend
Schuhe:
-
Feste Fersenkappe, guter Halt
-
Keine weichen oder engen Schuhe
-
Barfuß gehen stärkt die Muskulatur
Einlagen:
-
Stützen das Fußlängsgewölbe
-
Regelmäßig anpassen lassen
Fußgymnastik & Physiotherapie:
-
Zehenstand, Greifübungen, Barfußübungen
-
Stärkung von Fuß- und Beinmuskulatur
Gewichtsreduktion:
-
Entlastet die Füße spürbar
Bei Schmerzen:
-
Entzündungshemmende Salben / Medikamente
-
Wärme oder Kälte
Operativ
Wenn die Beschwerden durch konservative Massnahmen nicht behandelbar sind
Häufige OP-Verfahren:
-
Sehnenumlagerung oder -rekonstruktion
-
Korrekturosteotomie (Knochenumstellung)
Gelenkstabilisationen
Nach OP:
Ruhigstellung im Gips oder Walker, Entlastung an Gehstöcken, Thromboseprophylaxe, Physiotherapie
Leben mit Knick-Senkfuß
- Frühzeitige Erkennung hilft, Folgeschäden zu vermeiden
- Geeignetes Schuhwerk & regelmäßige Bewegung
- Einlagen regelmäßig kontrollieren
- Auch auf Beschwerden in Knie, Hüfte oder Rücken achten
Häufige Fragen
Richtet sich der Fuß von selbst auf?
- Bei Kindern oft ja
- Bei Erwachsenen nein – Behandlung notwendig
Wie lange braucht man Einlagen?
- Bis zur Ausreifung des Fußes oder bei Beschwerden dauerhaft.
Ist Sport möglich?
- Ja – besonders barfuß Gehen & gezielte Fußübungen sind sinnvoll.
Achillodynie (Schmerzen an der Achillessehne)

Was ist Achillodynie?
Achillodynie bezeichnet schmerzhafte Reizungen der Achillessehne – meist 2–6 cm oberhalb der Ferse. Es handelt sich nicht um einen akuten Riss, sondern um eine Überlastung der Sehne.
Typisch bei:
-
Läufer:innen und Sprungsportarten
-
Fußfehlstellungen (z. B. Knick-Senkfuß)
-
Sportlicher oder beruflicher Dauerbelastung
Unbehandelt kann die Reizung chronisch werden oder zu einem Sehnenriss führen.
Ursachen
- Überlastung durch Sport
- Plötzlicher Trainingsanstieg
- Fußfehlstellungen
- Falsches oder neues Schuhwerk
- Verkürzte Wadenmuskulatur
- Vorverletzungen oder OPs
- Alter oder rheumatische Erkrankungen
Symptome
- Schmerzen beim Gehen, Laufen oder morgens
- Druckschmerz an der Sehne
- Anlaufschmerz nach Ruhephasen
- Verdickung / Knotenbildung bei chronischem Verlauf
- Eingeschränkte Beweglichkeit
Diagnose
- Ärztliche Untersuchung
- MRT (bei Verdacht auf Riss)
- Ganganalyse bei Fehlstellungen
Behandlung
Konservative Therapie
Belastung reduzieren
- Sportpause, ggf. Fersenkeil
Physiotherapie & Übungen
Exzentrisches Wadentraining, Dehnen,
- Stoßwellentherapie (ESWT)
- Bandagen & Tapes
Einlagen & Schuhe
Dämpfung, Fersenpolster, bei Bedarf orthopädische Einlagen
Medikamente
- Entzündungshemmer (NSAR), kühlende Salben
Operative Therapie (selten)
Nur bei:
-
Langandauernden Beschwerden trotz intensiver Therapie (>6 Monate)
-
Teilrissen, starker Degeneration
-
Verkalkungen oder knöchernen Anbauten
OP-Verfahren:
-
Entfernung geschädigter Sehnenanteile
-
Naht oder Rekonstruktion
-
ggf. Sehnentransfer
Nach OP:
- Spezialschuh/Orthese + Physiotherapie
- Heilungsdauer: 3–6 Monate
Heilungsverlauf & Prognose
- Besserung oft über mehrere Wochen bis Monate
- Gute Prognose bei früher Behandlung
- Unbehandelt → Risiko für Sehnenriss
Vorbeugung
- Langsamer Trainingsaufbau
- Dehnen & Kräftigen der Wadenmuskulatur
- Passendes Schuhwerk
- Fußfehlstellungen korrigieren
- Regeneration nach Belastung
Häufige Fragen (FAQ)
Kann ich weiter trainieren?
- Nur gelenkschonend (z. B. Radfahren, Schwimmen)
Wie lange dauert die Heilung?
- Mehrere Wochen bis Monate – je nach Schweregrad
Hilft Dehnen wirklich?
- Ja! – exzentrisches Training ist besonders wirksam
Woran erkenne ich einen Sehnenriss?
- Plötzlicher Schmerz, "Schnappen", Kraftverlust → Sofort zum Arzt!

